Digitaler Produktpass: So nutzen Unternehmen die EU-Pflicht als Wettbewerbsvorteil
Der Digitale Produktpass wird in der Europäischen Union verbindlich eingeführt – erste Pflichten gelten bereits seit Februar 2025 für Batterien, weitere Produktgruppen wie Textilien, Elektrogeräte oder manche Bauprodukte folgen ab 2027 schrittweise. Grundlage ist die im Juni 2024 erlassene EU-Verordnung “Ecodesign for Sustainable Products Regulation” (ESPR).
Viele Unternehmen und Verbraucher haben dennoch kaum davon gehört, dabei wird der DPP in kurzer Zeit für nahezu alle Branchen relevant. Hersteller und Importeure müssen künftig detaillierte Daten zu Materialien, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und Umweltkennzahlen wie dem CO₂-Fußabdruck ihrer Produkte digital bereitstellen. Der Zugriff erfolgt standardisiert über eindeutige Kennungen wie QR-Codes oder RFID-Tags.
In diesem Artikel zeigen wir auf, was genau hinter dem Digitalen Produktpass steckt, welche Anforderungen die EU bereits beschlossen hat und wie sich Unternehmen heute strategisch vorbereiten können. Denn wer frühzeitig Transparenz in der Lieferkette schafft und passende IT-Systeme aufsetzt, kann die Pflichten nicht nur erfüllen, sondern auch Wettbewerbsvorteile sichern.
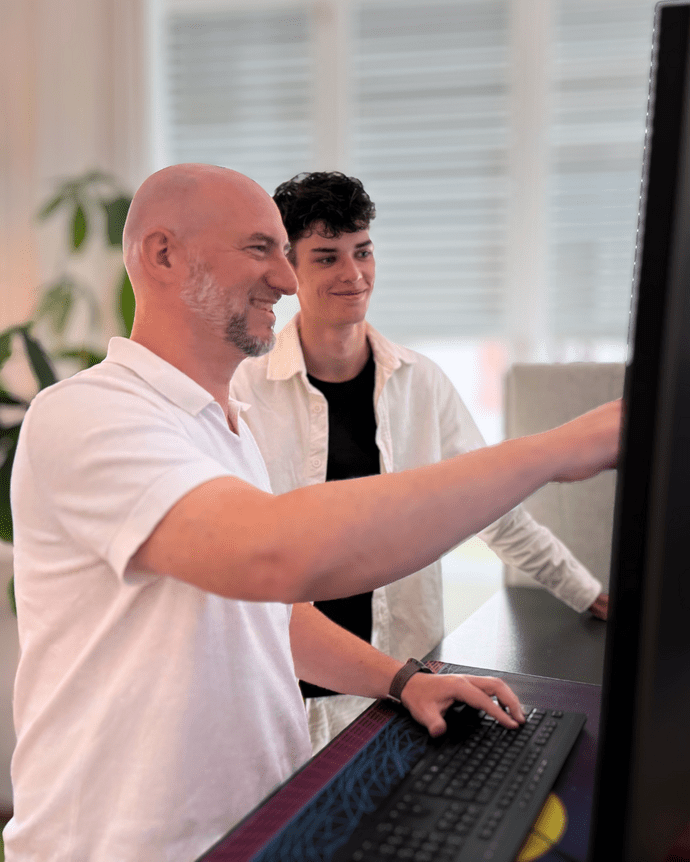
Was ist der Digitale Produktpass?
Der Digitale Produktpass (DPP) ist ein zentrales Instrument der Europäischen Union, das im Rahmen des „Green Deal“ und der Kreislaufwirtschaftsstrategie eingeführt wird. Das Ziel ist es, alle relevanten Informationen über ein Produkt, von der Herstellung über die Nutzung bis hin zum Recycling, digital verfügbar zu machen. Verbraucher, Unternehmen und auch Behörden sollen dadurch transparent nachvollziehen können, welche Materialien enthalten sind, wie nachhaltig und reparierbar das Produkt ist und welche Vorgaben für Wiederverwendung und Entsorgung gelten. Der DPP wird Schritt für Schritt für verschiedene Produktkategorien verpflichtend eingeführt.
Die Technik hinter dem DPP
Der Digitale Produktpass beruht auf einer standardisierten Datenarchitektur, die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen soll. Produkte erhalten eine eindeutige Kennung – beispielsweise per QR-Code, RFID oder NFC – über die alle relevanten Informationen abgerufen werden können. Diese Kennung ist persistent und ermöglicht die eindeutige Zuordnung von Materialien, Energieverbrauch, Reparaturhinweisen, Ersatzteilen oder CO₂-Bilanz. Für die Umsetzung werden internationale Normen und etablierte Standards herangezogen. Dazu zählen u. a. Arbeiten von ISO und europäischen Normungsorganisationen wie CEN und ETSI. Branchenspezifische Initiativen entwickeln ergänzende Modelle, etwa GS1 mit einer Datenarchitektur für globale Identifikationssysteme oder Catena-X für den Automobilsektor.
Wichtig ist dabei die Interoperabilität: Daten sollen maschinenlesbar, strukturiert und in unterschiedlichen Systemen nutzbar sein. Unterschiedliche Architekturansätze – zentral, dezentral oder hybrid – werden aktuell erprobt, um Datensouveränität, Sicherheit und Zugriffsrechte zu gewährleisten.
Digitaler Produktpass in der Benutzer-Praxis
In der praktischen Anwendung wird der Digitale Produktpass über einen eindeutigen Produktidentifikator zugänglich gemacht. Häufig wird der klassische EAN/Barcode künftig durch einen erweiterten QR-Code, NFC-Tag oder RFID-Chip ersetzt. Dieser Identifier ist mit einer Datenbank oder Plattform verknüpft, in der die hinterlegten Produktinformationen gespeichert sind.
Wird der Code gescannt, öffnet sich eine digitale Informationsseite, die sich je nach Nutzergruppe unterscheidet:
- Verbraucher sehen z. B. Angaben zur Materialzusammensetzung, Hinweise zur Reparierbarkeit, verfügbare Ersatzteile oder Anleitungen zur fachgerechten Entsorgung. Damit soll mehr Transparenz bei der Kaufentscheidung und Nutzung entstehen.
- Unternehmen in der Lieferkette erhalten erweiterte technische Daten, etwa zu verwendeten Rohstoffen, Produktionsprozessen oder CO₂-Bilanzen. Diese Informationen helfen, Nachhaltigkeitsziele einzuhalten und regulatorische Pflichten zu erfüllen.
- Behörden können über gesicherte Zugänge auf prüfungsrelevante Daten zugreifen, z. B. um die Einhaltung von Produktvorgaben, Ökobilanz-Standards oder Recyclingquoten zu kontrollieren.
Damit wird der Digitale Produktpass zu einem dynamischen Datenträger, der je nach Rolle unterschiedliche Ebenen von Informationen freigibt. Für Unternehmen bedeutet das: Je besser die Datenqualität und Systemanbindung heute ist, desto reibungsloser funktioniert die spätere Bereitstellung und Nutzung in der Praxis.
Die Rolle der GS1 in der DPP-Umsetzung (GS1 Digital Link)
Ein zentraler Diskussionspunkt bei der Umsetzung des Digitalen Produktpasses ist die Frage, welches Identifikationssystem sich in der Praxis durchsetzt. Hier spielt die internationale Standardisierungsorganisation GS1 eine wichtige Rolle. Sie stellt mit etablierten Systemen wie der GTIN (Global Trade Item Number) oder dem GS1 Digital Link bereits weltweit genutzte Lösungen zur eindeutigen Produktkennzeichnung bereit.
Wichtig ist dabei: Die Nutzung von GS1-Standards ist nicht verpflichtend. Die EU schreibt lediglich vor, dass DPP-Daten über einen eindeutigen, maschinenlesbaren Identifier abrufbar sein müssen. Dennoch sprechen viele Argumente dafür, dass GS1 in vielen Branchen zum De-facto-Standard werden könnte. Grund dafür ist die bestehende Verbreitung in Handel und Logistik, die internationale Interoperabilität sowie die Möglichkeit, bestehende Barcodes oder EAN-Codes relativ einfach durch QR-Codes im GS1-Format zu ersetzen.
Was ist GS1 Digital Link
GS1 Digital Link ist eine Weiterentwicklung der klassischen Produktkennzeichnung mit Barcodes oder EAN-Codes. Während ein herkömmlicher Barcode nur eine statische Artikelnummer (z. B. die GTIN) enthält, verknüpft der Digital Link diese Kennung mit einer Webadresse (URL). Damit wird jedes physische Produkt digital eindeutig identifizierbar und kann zusätzliche Informationen aus dem Internet abrufen.
Für den Digitalen Produktpass bedeutet das: Ein einziger QR-Code nach GS1-Standard kann sowohl den Anforderungen im Handel (z. B. Kasse, Lagerlogistik) gerecht werden als auch direkt auf die DPP-Daten verweisen. Wird der Code mit einem Smartphone gescannt, kann ein Verbraucher Informationen zu Inhaltsstoffen, Reparatur oder Entsorgung erhalten. Hersteller und Händler können denselben Code nutzen, um auf erweiterte technische oder regulatorische Daten zuzugreifen.
Der Vorteil liegt in der Interoperabilität: GS1 Digital Link ist rückwärtskompatibel zu bestehenden GS1-Systemen, sodass Unternehmen ihre bisherigen GTIN-Nummern weiterverwenden können. Gleichzeitig ermöglicht er eine flexible Erweiterung – je nach Rolle des Scanners (Kunde, Unternehmen, Behörde) können unterschiedliche Datenebenen angezeigt werden. Damit ist GS1 Digital Link ein möglicher Baustein, um den DPP praxistauglich und weltweit nutzbar zu machen.
Konkrete technische Lösungen für den Digitalen Produktpass (DPP)
Der DPP ist aktuell in einer Übergangsphase: Der politische Rahmen ist fest beschlossen, aber viele konkrete, technische Details sind noch in der Klärung. Während die Pflicht für erste Produktgruppen (z. B. Batterien) bereits eben seit Februar 2025 gilt, stehen verbindliche Vorgaben zu Datenformaten, Schnittstellen und Zugriffsrechten in vielen Bereichen noch aus.
Unternehmen wissen daher, dass sie handeln müssen, stoßen jedoch auf Unsicherheiten, welche Normen und Technologien sich langfristig durchsetzen werden. Diese Unklarheit betrifft besonders die Wahl der Systemarchitektur (zentral vs. dezentral) und die Definition von Mindestdatensätzen.
Noch nicht eindeutig geregelt ist, welche Datenfelder für welche Produktgruppen verpflichtend werden. Im Textilbereich wird etwa diskutiert, ob neben der allgemeinen Materialzusammensetzung (z. B. Baumwolle, Polyester) auch Informationen zu chemischen Behandlungen, Färbemitteln oder Recyclinganteilen verpflichtend angegeben werden müssen. Bei Bauprodukten wiederum ist offen, nach welchen Methoden der CO₂-Fußabdruck ermittelt werden soll und ob auch Lebenszyklusanalysen (LCA) für einzelne Materialien wie Betonstahl oder Dämmstoffe verpflichtend sind.
Auch die Tiefe der Lieferkette ist noch nicht final geklärt: Müssen Hersteller nur direkte Zulieferer berücksichtigen, oder sind auch Vorstufen (z. B. Rohstoffabbau) einzubeziehen? Unklar ist zudem, wie mit sicherheitsrelevanten oder geschäftskritischen Daten umgegangen wird – also welche Informationen öffentlich zugänglich sein sollen und welche nur berechtigten Partnern vorbehalten bleiben. Für Unternehmen bedeutet das eine Planungsunsicherheit: Sie wissen, dass Transparenz gefordert ist, können aber heute noch nicht vollständig abschätzen, welcher Umfang an Detailtiefe in ihren Datenprozessen notwendig sein wird.
Aktuelle DPP Lösungen am Markt
Trotz dieser Unsicherheiten existieren bereits zahlreiche Lösungsansätze.
Proprietäre Systeme:
- SAP Responsible Design and Production: Erweiterung der SAP-Suite, die Unternehmen hilft, Produkt- und Materialdaten in Einklang mit regulatorischen Vorgaben aufzubereiten. Sie unterstützt u. a. die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks und die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen.
- Siemens Teamcenter Sustainability: Modul innerhalb der PLM-Lösung Teamcenter, das Produktpässe mit Nachhaltigkeits- und Lifecycle-Daten verbindet und speziell für komplexe Industrien wie Maschinenbau oder Automotive optimiert ist.
- Dassault Systèmes „Sustainable Innovation Intelligence“: Teil der 3DEXPERIENCE-Plattform, mit Fokus auf Umweltwirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus und die Integration von DPP-Anforderungen in das Design.
Diese Lösungen punkten mit Stabilität, breiter Integration in bestehende Unternehmenssysteme und internationaler Skalierbarkeit. Allerdings sind sie kostenintensiv und eher auf größere Unternehmen zugeschnitten.
Neben diesen proprietären Angeboten entstehen zunehmend Open-Source-Ansätze, die stärker auf Interoperabilität und Anpassbarkeit setzen. MnestiX ist ein Beispiel für ein Open-Source-Tool, das bereits in der Industrie eingesetzt wird und Datenflüsse mit Standards wie Catena-X kompatibel macht. Das Digital Twin Consortium stellt Referenzimplementierungen auf Basis der Asset Administration Shell (AAS) bereit, die sich als Standard für digitale Zwillinge etabliert. Ergänzend werden Technologien wie dezentrale Identifikatoren (DID) und verifizierbare Credentials (VC) getestet, um sichere und vertrauenswürdige Datenweitergabe ohne zentrale Abhängigkeiten zu ermöglichen.
Digitale Zwillinge, Dezentrale Identifikatoren & verifizierbare Credentials
Ein zentrales Element der technischen Umsetzung des Digitalen Produktpasses sind Technologien, die weit über klassische Datenbanken hinausgehen. Ziel ist es, Produktinformationen nicht nur statisch bereitzustellen, sondern dynamisch, sicher und fälschungssicher entlang der gesamten Lieferkette verfügbar zu machen. Drei Schlüsselkonzepte rücken dabei in den Fokus: Digitale Zwillinge, Dezentrale Identifikatoren (DID) und verifizierbare Credentials (VC).
Digitale Zwillinge – das virtuelle Abbild des Produkts
Der Digitale Zwilling bildet ein Produkt digital in seiner Gesamtheit ab, von den Materialien über die Nutzung bis zum Lebensende. Formate wie die Asset Administration Shell (AAS) gelten hier als Referenzstandard, um einheitliche Schnittstellen und Datenmodelle zu schaffen. Digitale Zwillinge ermöglichen es, den Produktpass jederzeit aktuell zu halten, Simulationen durchzuführen und Informationen automatisiert mit Partnern auszutauschen.
Dezentrale Identifikatoren (DID) – sichere digitale Identität
DIDs stellen sicher, dass Produkte, Unternehmen oder auch Lieferchargen eine eindeutige digitale Identität besitzen. Diese Identitäten sind unabhängig von zentralen Autoritäten, was Manipulationen erschwert und die Kontrolle über die eigenen Daten stärkt. Damit können Hersteller Zugriffsrechte granular steuern und gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit von Datenflüssen erhöhen.
Verifizierbare Credentials (VC) – vertrauenswürdige Nachweise
VCs sind digitale Zertifikate, die bestimmte Eigenschaften oder Daten eines Produkts bestätigen, z. B. Herkunft, Materialzusammensetzung oder Nachhaltigkeitszertifikate. Sie sind kryptografisch gesichert und können jederzeit überprüft werden, ohne dass der gesamte Datensatz offengelegt werden muss. Damit schaffen sie ein hohes Maß an Transparenz und Vertrauen – sowohl für Geschäftspartner als auch für Endkunden.
Was bedeutet der DPP für Unternehmen
Für Unternehmen bedeutet der DPP eine tiefgreifende Veränderung: Sie müssen ihre Prozesse transparenter gestalten, Datenqualität sicherstellen und langfristig mehr Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Gleichzeitig entstehen Chancen, z. B. durch neue Geschäftsmodelle im Bereich Reparatur, Recycling oder Sharing. Für Konsumenten bietet der DPP Orientierung beim Kauf nachhaltiger Produkte, für die Politik ist er ein Werkzeug zur Umsetzung von Klimazielen und zur Schaffung eines funktionierenden Binnenmarkts für nachhaltige Produkte.
DPP für KMU in Deutschland
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor besonderen Herausforderungen: Sie verfügen häufig nicht über die Ressourcen für komplexe PLM- oder ERP-Erweiterungen, müssen aber dennoch DPP-Daten liefern. Für sie eignen sich vor allem modulare und leicht integrierbare Lösungen. Open-Source-Tools wie MnestiX bieten hier eine kostengünstige und flexible Einstiegsmöglichkeit, die sich an bestehende Systeme anbinden lässt. Darüber hinaus entstehen erste Cloud-basierte Plattformen, die DPP-Funktionalitäten als Software-as-a-Service (SaaS) bereitstellen. Diese können von KMU genutzt werden, um Daten zentral zu erfassen, zu pflegen und über standardisierte Schnittstellen bereitzustellen – ohne große Investitionen in eigene IT-Infrastruktur. Wichtig ist dabei die Wahl eines Systems, das offen genug ist, um spätere regulatorische Anpassungen ohne teure Migrationen umzusetzen.

Was Unternehmen jetzt konkret machen sollten
Die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Einführung des Digitalen Produktpasses ist ein sauberes und zukunftsfähiges internes Datenmanagement. Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Produktinformationen bereits heute in Systemen gepflegt werden, die sich später technisch korrekt an DPP-Lösungen anbinden lassen – etwa über standardisierte Schnittstellen (APIs) oder Integrationen in Product Information Management (PIM)-, ERP- oder PLM-Systeme.
Kernaufgabe ist es, Produktdaten vollständig, konsistent und maschinenlesbar vorzuhalten. Dazu gehören u. a. Materialzusammensetzungen, Lieferketteninformationen, Energie- und Ressourcendaten, CO₂-Bilanzen, Reparatur- und Wartungsinformationen, Zertifikate und Recyclinghinweise. Diese Daten stammen oft aus unterschiedlichen Quellen – vom Einkauf über die Produktion bis hin zu externen Zulieferern. Viele Unternehmen haben hier noch erheblichen Nachholbedarf, weil Informationen verstreut in Excel-Tabellen, Abteilungsdatenbanken oder gar nur in Dokumenten vorliegen. Je besser diese Daten heute strukturiert, zentralisiert und in geeigneten Systemen gepflegt werden, desto einfacher, effizienter und kostengünstiger wird die spätere Umsetzung der DPP-Pflichten. Pilotprojekte mit einem Teil des Produktsortiments oder in Kooperation mit Brancheninitiativen sind ein sinnvoller Einstieg, um interne Prozesse zu testen und Lücken zu identifizieren.
Als Digitalagenturunterstützen wir Unternehmen bei der Bewertung Ihrer aktuellen Systemlandschaft, entwickeln Konzepte für PIM-Lösungen und sind Experten für die Entwicklung von Datenschnittstellen. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass der Digitale Produktpass nicht nur zur regulatorischen Pflicht, sondern zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden kann.
